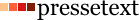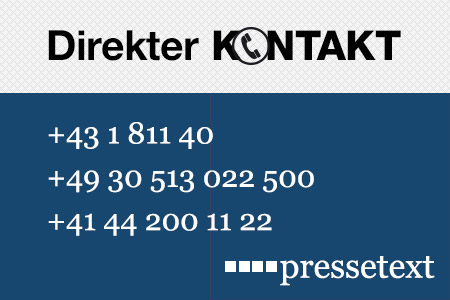Mehr Sachlichkeit in Moscheen-Debatte gefordert
Kenntnis der Geschichte kann zu Entschärfung der Diskussion beitragen
 |
Moschee im oberbayrischen Penzberg: Einbindung ins Ortsbild gelungen (Foto: islam-penzberg.de) |
Frankfurt (pte037/28.04.2009/13:58) Die anhaltende Debatte um den Bau von Moscheen braucht eine Versachlichung der Argumente, damit Lösungswege gefunden werden können. Dafür plädiert Bärbel Beinhauer-Köhler, evangelische Religionshistorikerin an der Universität Frankfurt http://www.evtheol.uni-frankfurt.de gemeinsam mit dem Essener Politologen Claus Leggewie. Im Buch "Moscheen in Deutschland. Religiöse Heimat und gesellschaftliche Herausforderung" zeigen die Autoren Aspekte der Diskussion um den Moscheenbaus, die als Ansatzpunkte für eine Verständigung zwischen Befürwortern und Gegnern wirken könnten.
"Vergleicht man Moscheen mit den Kirchenbauten, ergeben sich interessante Wechselwirkungen und Parallelen, die in der aktuellen Debatte kaum präsent sind", so Beinhauer-Köhler im pressetext-Interview. Ein Beispiel dafür seien die Gebetsnischen, die in den Moscheen stets nach Mekka ausgerichtet sind. "Sie gehen unter anderem auf die Apsis der christlichen Kirche zurück, sowie auf den Thoraschrein in der jüdischen Synagoge." Eine Entschärfung der Perspektiven könne auch das Wissen um die Herkunft der muslimischen Moscheekuppeln im türkischen Stil bieten. "Sie lehnen sich an den Baustil der Hagia Sophia in Istanbul an, deren Baumeister jedoch ursprünglich Christ war. Die Stile haben sich im Laufe der Zeit untereinander befruchtet", so die Religionswissenschaftlerin. Europa habe besonders im 19. Jahrhundert große Offenheit für orientalische Formen gezeigt, ebenso könne man auch bei mehreren türkischen Moscheen neoklassizistische Elemente entdecken.
Wenngleich dies Äußerlichkeiten seien, lösen diese als Zeichen und Symbole bei Benützern wie auch bei Betrachtern der Gebäude starke Emotionen hervor, so die Wissenschaftlerin. Das Bewußtsein der Hintergründe könne es ermöglichen, dass sich die Architektur neuer Moscheenbauten stärker für westliche Stadtbilder öffne. Als Beispiel für diese Öffnung nennt Beinhauer-Köhler die 2006 errichtete Moschee im bayrischen Penzberg. "Das Bauwerk orientiert sich an einer westlich geprägten Sichtweise und an moderner Architektur. Seine Lichtgestaltung macht es auch für nichtmuslimische Anrainer zum ästhetischen Blickfang." Die Verwirklichung des Projekts sei dem Entgegenkommen verschiedener Akteure zu verdanken. "Der kritische Teil der Anrainer wurde im Vorfeld gut in die Planung eingebunden, und die Durchführung erfolgte durch lokale Handwerker und Baufirmen. Es brauchte jedoch auch seitens des Moscheevereins eine längere Diskussion, da die ästhetische Form vielen Nutzern fremd war."
Während die Wurzeln der aktuellen Diskussion um muslimische Gebetsräume im deutschen Sprachraum beim Beginn der Gastarbeiter-Bewegung in den 1960-er Jahren liegen, geht ihre Geschichte viel weiter zurück. "Unter Diplomaten und Händlern gab es schon lange Muslime, zudem blieben Einzelpersonen als Kriegsgefangene der Türkenkriege zurück." Friedrich der Große habe ihm als 'Geschenk' überreichte muslimische Gefangene in Potsdam einen ersten Gebetsraum zur Verfügung gestellt, was laut Beinhauer-Köhler sowohl aus toleranter Grundhaltung wie auch aus Pragmatismus geschehen sei. "Das wiederholte sich im ersten Weltkrieg, als kriegsgefangene Muslime aus dem britischen, französischen und russischen Heer bei Berlin interniert waren. Man behandelte sie gut und errichtete eine erste Moschee aus Holz in Deutschland - in der Hoffnung, dass die Gefangenen später zu den Osmanen überlaufen würden."
Im Moment ist ein Trend hin zu repräsentativen Moscheenbauten zu beobachten, erklärt Beinhauer-Köhler. "Menschen, die früher als Gastarbeiter kamen, orientieren sich erst seit etwa 20 Jahren bewusst in Richtung eines dauerhaften Hierbleibens. Sie brauchen Räumlichkeiten zur Ausübung ihrer Religion, und es ist verständlich und Teil ihrer Integration, dass die Situation der aktuellen Hinterhof-Moscheen auf Dauer nicht befriedigend ist." Seitens der nichtmuslimischen Gesellschaft beobachtet Beinhauer-Köhler einen langsamen Gesinnungswandel. "Da es den Menschen fremd war, gestaltete sich die erste Phase der Moscheebauten schwieriger. Mittlerweile ist in städtischen Gebieten die Akzeptanz etwas gestiegen."
Die Positionen von Befürwortern und Gegnern des Moscheenbaus seien von Ideologien und Identitätsfragen bestimmt, wobei Kirchenvertreter teilweise gesprächsbereit seien und in Kontakt mit Moscheevereinen stünden, so die Religionswissenschaftlerin. Damit ein Moscheebau auf Akzeptanz treffe, sei die Wahrnehmung des muslimischen Bevölkerungsteils eines Stadtteils durch die Bevölkerung unabdingbar. Das Argument der fehlenden Toleranz christlicher Bauten in muslimischen Länder hält Beinhauer-Köhler für nicht historisch haltbar. "Christen sind in der muslimischen Welt eine akzeptierte Minderheit und verfügen seit alters her über Kirchen. Wenn es aktuell zu Verboten von Kirchenneubauten kommt, so hängt das von der Politik des jeweiligen Landes ab." Das Aufrechnen gegenseitiger Taktiken führe jedoch zu keinem konstruktiven Ergebnis. "In pluralen Gesellschaften müssen verschiedene Bevölkerungsgruppen friedlich miteinander leben können", so die Frankfurter Forscherin zu pressetext.
(Ende)| Aussender: | pressetext.deutschland |
| Ansprechpartner: | Johannes Pernsteiner |
| Tel.: | +43-1-81140-316 |
| E-Mail: | pernsteiner@pressetext.com |